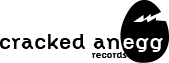Die Presse
Böse Sprachbilder für Helden des neuen Wienerlieds: Auf „Schau di an“ von den Strottern hat Dichter Peter Ahorner alle Texte verfasst.
Was dunkle Poesie betrifft, gehen die Strottern auch mit anderen strandeln. Gerne haben sie mit der Wortkunst von Wilhelm Busch und Julian Schutting geflirtet, haben Peter Orthofers Doppelbödigkeit mit ihrer sanften Musik verzärtelt, Lieder von Tom Waits eingewienert und Peter-Herz-Texte entkitscht. Zuweilen hat Sänger und Geiger Klemens Lendl sogar selbst gedichtet – mit durchaus guten Resultaten. Am innigsten in Musik gesetzt waren aber stets jene Szenarien, die dem wolkigen Denken des Dichters Peter Ahorner entsprungen sind. Seit über 20 Jahren besteht diese lose Zusammenarbeit. Auf ihrem neuesten Opus „Schau di an“ hat Ahorner erstmals sämtliche Texte verfaßt.
Die Strottern haben sie abliegen lassen. Lendl und David Müller, sein Kollege an der Kontragitarre, warten solange, bis sie den zumeist schrulligen Szenarien musikalisch auf die Spur kommen. Das kann dauern. Das skurrile Poem „Mei Regnschiam“ mit dem die Strottern eröffnen, lag sogar über 20 Jahre unbeachtet in einer Lade. Die Geschichte von einem Regenschirm, der seinen dem Alkohol zugeneigten Träger immer wieder in Schienenfahrzeugen vom Liliput-Zug bis zur Badnerbahn vergißt, ist nicht schlechter geworden.
Die Liebe zum Detail ist bei Ahorner frappierend. Seit H.C. Artmann hat niemand mehr exakter den Gemütszustand des Wieners anhand von Requisiten erfaßt. In „Wean um hoiba fiere“ spielen Veronal-Tabletten und ein in der Vitrine lauerndes Bauchfleisch tragende Rollen. Wenn sich die Schlaftabletten verstecken, muss das fette Essen die Wirkung des Hypnotikums übernehmen. Als Gast illustriert Karl Stirner an der Zither diese Wiener Depression auf gewohnt abgründige Weise. „A Weana mocht des ned, dea stöht da ka haxl, ea reißt da s aus.“ heißt es in „Heazz&Haxn“ maliziös.
Die Bläser Martin Ptak und Martin Eberle konterkarieren die bösen Sprachbildern mit launigen Luftsäulen. Die Doppelbödigkeit der Musik entspricht hier exakt der unguten Seelenlage, die rasch zwischen Larmoyanz und Sadismus herumspringt. Ein Wiener „bricht da ned dei Heazz, ea faschiats und inhaliats.“ Lendl verstärkt diesen Dialekt der Wiener Seele, indem er betont zart singt. Das falsche Idyll ist ein Lieblingstopos. Ein Lied wie „Do bleib i liaba“, wo „daNewö, Woikn und de Feichtn“ dominieren und sich die Sonne gar nicht mehr traut zu scheinen, ist ein ideales Lied für Lichtscheue in Hitzewellen, wie sie uns derzeit plagen.
Das titelgebende Liebeslied, in dem „die Fussaln nach Bussaln“ schreien, zeigt eine Form von Minne, die nahe an der Entmündigung des geliebten Du ist.„Schau di an, wia du ausschaust, ob du siachst di jo ned.“ heißt es da. Und weil in dieser Projektion das geliebte Subjekt als Patscherl vorgestellt wird, wird die Gier immer größer. Wie beim Wiener Blaubart, den einst Qualtinger besang, haben sich am Ende die Messer von ganz allein bewegt.
Ähnlich geht es in „Faluan“ zu. „Was hot denn das Mädal im Frühling faluan?“ fragt Lendl darin subtil hinterfotzig. Das Bürscherl verliert selbstverständlich in weiterer Folge den Verstand.
Das im Frühling aufgenommene CD-Album ist einmal mehr ein elegant vertontes Pandämonium des Wieners. Im Herbst wird es auf Vinyl nachgereicht.
Samir Köck – 25.06.2021