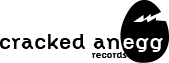Die Presse am Sonntag
I warat do! Es sind gute Zeiten für Freunde des gefühligen Wiener Liedgutes. Auch dank der Strottern.
Irgendwo eingezwängt zwischen traditionellem Wienerlied, Austropop und modernem Liedermachertum steht das Neue Wienerlied. Und es hat derzeit Hochkonjunktur – auch wenn sich nicht jeder Vertreter zur Szene bekennen will.
Darüber, was einem Wiener alles ins Gemüt geht, hat H.C. Artmann ein schmuckes Gedicht geschrieben. In seiner Aufzählung wichtig waren identitätsstiftende Dinge wie „a schachtal dreia en an pisoa“, „a schas met quastln“, „quagln en essechundööl“, „es gschbeiwlad fua r ana schdeeweinhalle und en hintagrund auf jedn foe: da liawe oide schdeffö!“. Helmut Qualtinger hat dieses Poem 1966 mit vollendetem Rhythmusgefühl und herrlicher Maliziosität gesungen. Qualtingers Album „Singt schwarze Lieder“ gilt als gemeinhin bestes wienerisches Album aller Zeiten. Noch vor dem mit dem kongenialen André Heller aufgenommenen „Heurige und gestrige Lieder“ von 1979, einer Sammlung gut abgelegener und frisch komponierter Klassiker wie „Allan sei is ärger als Ratzen fressen“ und „Krüppellied“. Fühlung mit der Vergangenheit hatte Heller schon 1974 mit „A Musi! A Musi! (Wienerlieder des 18., 19. und 20. Jahrhunderts)“.
In ähnlichem Austausch sind die aktuellen Protagonisten des wienerischen Lieds. Das Kollegium Kalksburg brilliert auf seinem neuesten Opus „Ewig schod drum“ mit einer Coverversion von André Hellers „Unhamlich leicht“. Die Strottern, große Fans von der Liedkunst eines Kurt Sowinetz, interpretieren jüngst im Wiener Konzerthaus sogar den durch Heinz Conrads berühmt gewordenen „Praterboogie“. Auch Hellers „Und dann bin i ka Liliputana mehr“ zelebretierten sie streicherumflort. Was ist das Konstante am wienerischen Gemüt und seinen Ausdrucksweisen über die Jahrhunderte? Was ist das unzerstörbar Wienerische am Wiener? Klemens Lendl, der Sänger und Geiger der Strottern, ortet im gebrochenen Selbstbewusstsein das Zentrum des wienerischen Gemüts: „Diese Gleichzeitigkeit von einander widersprechenden Gefühlsströmungen, die gibt es nicht oft auf dieser Welt.“
Tom Waits könnte ein Wiener sein. Nicht nur, dass die Strottern sein „All The World Is Green“ und das Kollegium Kalksburg sein „Way Down In The Hole“ gecovert haben, der heisere Kalifornier hat 2004 mit „Green Grass“ ein Lied aufgenommen, das aus der gleichen Perspektive wie Ludwig Hirschs „I lieg am Ruck’n“ die Liebe über der Erde anschmachtet. „Lay your head where my heart used to be, hold the earth above me, lay down in the green grass, remember when you loved me.“ Waits ist eine rare Ausnahme in der weiten Welt des Pop. Allenfalls ließe sich noch Leonard Cohen wegen seines Wesens, das Depression und Humor auf ideale Weise verband, eingemeinden. Lou Reed war schon wieder nicht. Der war zwar ein virtuoser Grantler, besaß aber null Schmäh.
Umgekehrt will hierzulande nicht jeder Teil der boomenden Szene „Neues Wienerlied“ sein. Der Liedermacher Ernst Molden beispielsweise, obwohl das gesamte Pandämonium des Wienerischen – vom Quiqui (dem Tod) bis zu den süßen Madln – in seinen Songs herumspaziert und er detailgetreu wie niemand sonst die Poesie des Hiesigen einfängt. Und überhaupt, wo sind die Grenzen zwischen Pop und Neuem Wienerlied? Bei Künstlern wie dem Nino aus Wien und Voodoo Jürgens fällt die Einordnung schwer. Immerhin hat Molden heuer mit einem Kollektiv, dem auch der Nino und der Voodoo angehörten, die Wiener Festwochen mit einem Potpourri an wienerischen Liedern eröffnet. Ein weiteres Indiz für die Hochkonjunktur des neuen Wienerliedes ist, dass immer mehr Künstler ihre Veröffentlichungen auch auf Vinyl herausbringen. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln edierten gerade ihr Debutalbum von 1997 auf Schallplatte. Und die Strottern versprechen für Herbst ihr aktuelles Werk „Waunsd Woadsd“.
Gute Zeiten sind angebrochen für Freunde des rinnaugerten, des deftig-erotischen, des manchmal surrealen und nie ohne Leichtsinn auskommenden Genres. Während die operettenhafte Interpretation á la Heinz Zednik glücklicherweise fast vollständig von der Bildfläche verschwunden ist, hat die Musik der Pioniere des Neuen Wienerlieds immer noch Saison: die weichen Texturen des jüngst verstorbenen Karl Hodina, die bissigen G’stanzln von Roland Neuwirth. Wermuthstropfen sind bloß Rundfunk und Fernsehen, die in ihrem reflexartigen Kniefall vor dem Massenpublikum das wienerische Lied breitflächig negieren. Egal, es lebt trotzdem gut. Eine neue Generation an Hörern erfreut sich am larmoyanten und hinterfotzigen Figurenarsenal des Genres. Karl Hodina, gefragt was für ihn das Wesen des Wienerischen ausmacht: „Das Chamäleonhafte, das Charakterschwache. Der Wiener verachtet die Welt immer nur ein bisserl. Er leistet sich den Luxus einer gewissen Provinzialität. Und er verwendet den Konjunktiv fast inflationär: „I warat jetzt do‘ – was für ein Ausdruck!“
In die Fußstapfen des großen H.C. Artmann ist unzweifelhaft der Dichter Peter Ahorner getreten, der entscheidend am Durchbruch der Strottern beteiligt war. Aktuell mit seinem Gedicht „Wean braucht an eiganan Blanetn“, in dem der über die Weltlage verzweifelte Herrgott in grüblerischer Stimmung der Stadt einen eigenen Himmelskörper zugesteht. „Ois Gott hau i mi glott in de Kinettn“, freut er sich über ein „Leo“, ein Refugium, das ihm Schutz bietet vor den Zumutungen des Universums.
Samir Köck – 27.05.18