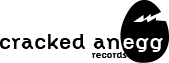Die Presse
Zauberer des Wiener Dialekts Ahorner rezitiert auch selbst.
Die Strottern vertonen die Lyrik von Peter Ahorner schon seit 15 Jahren. Nun gibt es mit „Wean du schlofst“ sein überfälliges CD-Debüt.
Oft stellt er sich die Frage, was denn die Essenz der Wiener Stadt sein könnte. In letzter Zeit flimmert ihm diesbezüglich das Bild einer Tablette vor dem innere Auge. „Ein Pulverl ist Wien, eine Medizin: Vienna forte“, murmelt Peter Ahorner in jenem Lokal, das seiner oft schwierigen Gemütslage am besten entgegenkommt. Mit wachem Auge überblickt er das Bobo-Völkchen im Hold in der Josefstädterstraße. Da und dort ragt ein Charakterkopf hervor, mit dem der Dichter besser bekannt ist: etwa Heinz Frank, Meister des Karos und der rätselhaften Sentenz. Auch der Theatermann Robert Quitta lugt scheu herüber. Die beiden verstehen, wenn Ahorner in diesem Pulverl namens „Vienna forte“ keinen Stimmungsaufheller sieht. „Es ist eher was, mit dem man dann grau in grau sieht“, raunt er geheimnisvoll. Eigentlich wohnt er am Rande der Cottage. Trotzdem zieht es ihn immer wieder ins Hold. Das mediterrane Flair behagt ihm. „Wissen Sie, was Deutsche gern sagen? Ihr Wiener sprecht nicht Deutsch, ihr singt es“, sagt Ahorner.
Sprache war für den 1956 nur durch einen Zufall in Vorarlberg zur Welt gekommenen Urwiener früh ein wichtiges Labsal, aber auch eine Waffe, der Beschränktheit seines Milieus zu entkommen. „Mein Vater war Offizier. Ich bin in der Albrechtskaserne im zweiten Bezirk aufgewachsen. Daheim musste man schön sprechen, also Hochsprache. Durch den Maschendrahtzaun hab ich dann was ganz anderes gehört. Die Rekruten haben unglaublich g’schert dahergered’t. Mich hat das schon als Fünfjährigen total fasziniert. Ich hab auch die eine oder andere Watsche kassiert, wenn ich Dialektausdrücke ausprobiert hab“, erzählt er stolz.
Schon als Bub las er viel Mörike und Heine, aber eben auch Peter Altenberg, H.C. Artmann, Helmut Qualtinger. „Solche Leute bewundert man“, sagt er bescheiden – er, der mit seinen hintersinnigen Gedichten und Liedtexten längst ihr Erbe angetreten hat. Ahorners Weg in die Kunst war keine Rutsche – er hat jahrelang in großen Werbeagenturen Slogans gedrechselt. Existenzwendend war die Begegnung mit dem begnadeten Wienerlied-Duo Die Strottern, und zwar für beide Seiten. „Wir haben gleich eine Chemie gehabt“, sagt Ahorner über die schicksalshafte Begegnung. Und stößt mit den berühmten Worten E.T.A. Hoffmanns nach: „Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ Seit fast fünfzehn Jahren vertonen Klemens Lendl und David Müller nun schon die Lyrik Ahorners kongenial. Das Jubiläum nahm man zum Anlass, die 2003 entstandene, längst vergriffene CD „Mea ois gean“ live neu aufzunehmen.
Ahorner gerät ins Schwärmen. „Die Strottern haben einfach eine unbeeinflussbare Eleganz. Ihren Zauber macht aus, dass sie nie hudeln. Ihre Musik ist sehr intensiv. Sie erfordert Aufmerksamkeit, und die bekommt sie auch.“ Perlen von Ahorners Wortkunst, etwa „Café Westend“ und „Wos si auszoid“, blühen hier wieder auf. Dieses schöne Werk wird nun im Format eines Doppelalbums gereicht. Die zweite CD darin nennt sich „Wean du schlofst“ und stellt Ahorner als Rezitator seiner eigenen Texte vor. Zuweilen singt er gar.
Es sind Texte voller Hintersinn, die den Wiener im Widerstand gegen die Moderne zeigen. Alles setzt er im Kampf gegen den Fortschritt ein: Larmoyanz, Sturheit, Opportunismus und nicht zuletzt seine Verfressenheit. Ein Highlight ist „Psychodeli“, das eine Art Naschmarkt für das Innerste vorstellt. In schönster Akkuratesse mixt Ahorner Esoterikjargon und Küchenlatein. Maliziös preist er seine Spezialitäten an. Etwa eine „Vaterübertragung, handgefüttert“. Oder einen „äußeren Schweinehund, frisch ausgelassen, mit einer Batz’narchaik“. Nur die Härtesten entscheiden sich für die „austherapierte Drecksau auf Dinkelbasis“.
Nützt ihm die Dichterei, abgesehen vom schmalen Geld, das sie für ihn abwirft? „Das Schreiben beruhigt mich“, erklärt er und kehrt dabei den Romantiker heraus. „Wenn es mir ganz dreckig geht, schreib ich die schönsten Liebesgedichte und umgekehrt.“ Dann führt er das Achterl an die Lippen und blickt dorthin, wo er Seligkeit erhofft.
Samir H. Köck – 03.01.2014