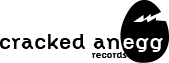Profil | 21
Die Strottern sitzen im Kaffeehaus und denken über das Altwerden nach. Sie haben Recht, es ist Zeit. Sie werden vierzig. Klemens Lendl der Mann mit den buschigen Koteletten, feiert demnächst, David Muller, der Wuschelkopf, im übernächsten Jahr den runden Geburtstag. Seit zwei Jahren leben die beiden jetzt von ihrer Musik. Sie leben nicht in Saus und Braus, aber immerhin muss Lendl keine Texte für Corporate Magazine mehr schreiben, um die Miete bezahlen zu können. Die Strottern sind seit 15 Jahren die Strottern, aber jetzt ist Strotternsein endlich ein Beruf.
Sie singen und spielen Wienerlieder. Das klingt einfacher, als es tatsachlich ist. Zwar ist die Weanerstadt durchaus vielbesungen, in historischen Liedern wird sie als Urmütterchen porträtiert, in anderen als alte Frau, die man erschlagen sollte, und es gibt in Person von Karl Hodina und Roland Neuwirth auch lebendige Klassikaner des Genres. Mit diesen sind die bald 40-jahrigen Wienerliederinterpreten und -reformatoren jedoch weder verwandt noch verschwägert, höchstens ein bisschen bekannt.
Die Strottern singen Wienerlieder, weil sie nun einmal aus Wien kommen und weil ein paar Zufälle dafür gesorgt haben. Als sie vor vielen Jahren ein bisschen Jazz miteinander spielten und sich als Hochzeitscombo ein Zubrot verdienten, rutschten ihnen auch Wienerlieder ins Programm, weil der Großvater Klemens Lendls gerne Wienerlieder hörte. Die Stimmung, das Süße und das Sentimentale, das sowohl im Text als auch in der Musik wohnte und so gut an der Grenze zur Persiflage interpretiert werden konnte, ohne seine Wirkung zu verlieren, machte den beiden Musikern von Beginn an Freude und erwies sich als wirkungsmächtig. Keine Lieder setzten mehr Trinkgeld um als die fünf klassischen Hadern, die sie sich aus dem Liederbuch ausgesucht und einstudiert hatten: David Muller an der akustischen Gitarre, Klemens Lendl mit seiner Gute-Laune-Geige und einem performerischen Talent, das den exzentrischen Auftritt genauso befeuerte wie den lyrischen Gesang.
Mehr Ambition steckte gar nicht hinter der durchaus originellen Show der Strottern. Sie verehrten keine musikalischen Urgroßväter aus der Schrammeldynastie oder Dudlerinnen aus Hernals. „Der Sowinetz hat mir gefallen“, sagt Klemens Lendl, „und der Qualtinger natürlich. Das waren genauso Quereinsteiger ins Wienerlied wie wir.“
Der Name, den sich Lendl und Müller verpassten – die Strottern – ist freilich alles andere als ein Quereinsteigerbegriff: Er stammt aus dem emblematischen Wienerlied „Wann i amal stirb“, in dessen zweiter Strophe der Erzähler sich an seine Zuhörer wendet und ihnen Anweisungen gibt, wie sie sein Ableben zu feiern haben: „Os liabe Leit, Leit, Leit, tuat’s es den Strottern sagn / dass auf die Butt’n schlagn / und singts mit Freid, Freid, Freid / an meiner Grabesstell‘, allweil fidel.“
Das funktioniert perfekt als Programmatik, zumal der Begriff „Strotter“ als „Gauner, Landstreicher, Strauchdieb“ erklärt werden kann, aber, wie das Wiener Mundartwörterbuch weiß, auch für Menschen steht, die „nach Verwertbarem suchen“. Das passt so gut auf das, was die Strottern – die Band – musikalisch anstellen, dass sie es kurzerhand zu ihrer Theorie erklärt haben. Nach Verwertbarem suchen: Das machen die Strottern im mehr oder weniger reichen Wiener Liedschatz. Und wenn sie nichts finden, singen sie halt ihre eigenen Lieder.
Um zu den eigenen Liedern zu finden, mussten die Strottern zuerst Peter Ahorner treffen. Der Dichter Peter Ahorner beherrscht die rare Kunst, Texte im Wiener Dialekt zu verfassen, denen die Musik bereits innewohnt. In Ahorner fanden die Strottern einen Ausnahmekönner, der ihnen an der messerscharfen Grenze von tief empfundener Kunst und Schmachtfetzen den Weg wies und sie mit den beeindruckenden Geschichten für das erste Album „mea ois gean“ alimentierte.
So entstanden klandestine Klassiker wie „Cafe Westend“ oder „Mea ois gean“, eigensinnige, unverkünstelte Lieder, in denen sich die Strottern frei spielen konnten von den gar so traditionellen Nummern, die sie jahrelang mit sich herumgetragen hatten. Die Geschichten erzahlten schwerpunktmäßig vom Scheitern und vom Tod und von der Liebe: Darauf hat sich das Wienerlied nun einmal festgelegt.
„Es hat mich sehr bewegt“, sagt Klemens Lendl, „als ich auf der Bühne das erste Mal ,ich liebe dich‘ gesungen habe.“ Diese fast schüchterne Ehrfurcht, der Respekt vor den Liedern, die sie selbst komponiert haben, ist den Strottern bis heute geblieben. Sie können lustig und laut sein, klar, und Klemens Lendl ist ein generöser Moderator des eigenen Stoffs, pointensicher und sympathisch, aber wenn es darauf ankommt, wenn ein Lied die vollkommene Stille braucht, das innere Schweigen zwischen den Zeilen, dann lauschen die Strottern auf der Bühne mit geschlossenen Augen in die eigene Musik hinein, um dem Geheimnis, das ihr innewohnt, wieder ein kleines Stück näherzukommen.
In ihren Konzerten spielten sie alte und neue Lieder durcheinander. Sie vertonten Texte von Wilhelm Busch. Klemens Lendl begann eigene zu schreiben. Die Strottern gruben aus einer unüberschaubaren Menge alter Wienerlied-Literatur solche aus, die ihnen gültig erschienen und zu ihrer Art der Interpretation passten, zu diesem konzentrierten, nah an der seelenvollen Grobheit des Blues gebauten Stil, der aus ein bisschen Instrument und Stimme mit Herz und Hingabe etwas Außergewöhnliches, Zupackendes erzeugt.
Die Strottern liebten Wien als das spirituelle Zentrum ihrer Musik und plagten sich damit. Sie veränderten die Unterzeile zu ihrem Programm von „Lieder aus Wien“ zu „Leider aus Wien“. Sie fühlen sich einer neuen Generation von Wienerlied-Bands zugehörig, sind mit dem „Kollegium Kalksburg“ befreundet und mit den vergnügten Shootingstars von ,,5/8 in Ehren“ freundschaftlich und professionell verbunden (David Muller besorgt deren Aufnahmetechnik); sie schrieben sogar die witzige und treffende Hymne „Grüß Gott, ich bin das Wienerlied“, in dem sie den Bogen von Karl Hodina bis zu ihren Freunden Karl Stirner und Hannes Löschel schlugen – und dabei doch auf rührende Weise klarmachten, dass es sich bei den Strottern und dem Wienerlied um eine Zufallsbekanntschaft handelt, die sich halt zu etwas Ernstem ausgewachsen hat.
Soll man darüber weinen, soll man darüber lachen? Keine Ahnung, aber allein mit dieser spezifischen Ungewissheit landen die Strottern sowieso genau beim Wienerlied. Sie nahmen erschütternde Liebeslieder wie ,,I gab at ois dafia“ auf. Probierten neue Sounds aus, spielten mit der „Jazzwerkstatt Wien“ das wilde, orchestrale Album „Elegant“ ein. Sie packten die traditionellen Songs ihres Liveprogramms auf das Album „Das größte Glück“ und zeigten, wie wild entschlossen sie im Frack der Großväter aus der Haut fahren können.
Die Strottern sitzen im Kaffeehaus und sprechen über Zeit. Sie werden zwar alt, haben es aber trotzdem nicht eilig. Die Preise, die ihnen verliehen wurden, der Amadeus, der Deutsche Weltmusikpreis, okay, es gibt auch erfreuliche AIterserscheinungen. Aber deshalb Tempo aufnehmen und ein Album herausbringen, bevor es wirklich Fertig ist? „Oft liegen die Texte, aus denen wir Lieder machen, ewig lang herum“, sagt David Müller. Sie werden gelesen, ausprobiert, verworfen, wieder hervorgeholt. Die Musik entsteht oft Jahre, nachdem ein Text geschrieben wurde. Dann wird ein Lied auf der Bühne ausprobiert, und irgendwann, wenn genug neue Lieder beisammen sind, wird ein Album aufgenommen. Das ist dann allerdings so, wie die Strottern sich ein neues Album vorstellen.
In dieser Woche erscheint „Wia tanzn is“, ein Wahrheitsbeweis für die Kraft und Zukunftsträchtigkeit des neuen Wienerlieds. Mit den Strottern spielen auf dem Album die Blechbläser Martin Eberle und Martin Ptak. Sie ziehen den warm und unmittelbar aufgenommenen Songs eine musikantische, sinnliche Ebene ein und komplettieren aus dem Rückraum mit blauer Kraft die erstaunlichen Lieder, Lamenti, Konfessionen.
Das Titellied, ein Liebeslied, verwirrend und zum Weinen schön. Ein charmantes Beziehungsdramolett, zu dem Daniel Glattauer den Text beigesteuert hat. Peter Ahorners Story eines traurigen U-Bahn-Kontrollors, berückend schon und zum Kopfschütteln traurig. Sprachkapriolen im Dreivierteltakt und ergreifende Gospelstürme mit großem Chor. Ganz am Schluss Andrea und Ennio Morricones „Tema d’Amore“ mit Klemens Lendls Text, ein ganz großes Liebeslied: ein ganz großes Wienerlied, eines von „a boa klane wunda“, wie die Strottern sie sich selbst geschrieben haben.
„Wir werden immer langsamer“, sagen Klemens Lendl und David Muller. Wenn alles langsamer wird, vergeht nämlich die Zeit nicht so schnell.
Christian Seiler – 21.05.12